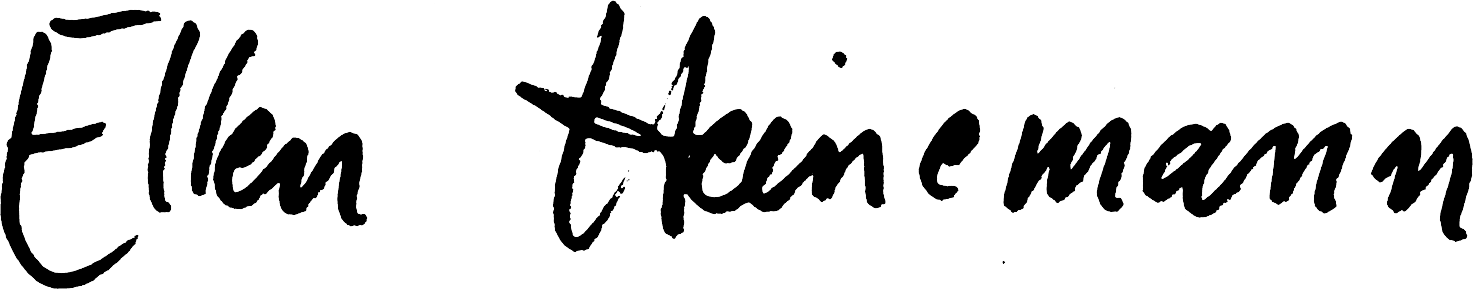Betrachten wir erst einmal eine Arbeit, die mit Malerei wenig, viel aber mit der Anordnung von Farben zu tun hat. „Sammlung“ nennt Ellen Heinemann eine Arbeit, die 1978 begonnen wurde, immer noch nicht abgeschlossen ist und vermutlich auch nicht abzuschließen sein wird, weil sie sich voll in den Strom der warenproduzierten Farben stellt. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Plastikgegenständen aus allen Bereichen des alltäglichen nützlichen oder spielerischen Lebens, die auf Tischen organisiert ausgebreitet werden. Um in der Begrifflichkeit unserer werkprozessualen Geschichte zu bleiben: auf den vom jeweiligen Ausstellungsort angebotenen Präsentationsflächen (das können auch Vitrinen oder Raumnischen sein) wird den Gegenständen der Platz angewiesen. Hier ist, bei der Künstlerin wie beim Betrachter die Wahrnehmung auf Alarm gestellt. Wem wird Platz angewiesen? Den farbigen Gegenständen, den Farben und den Gegenständen? Da doch die Farben von den Gegenständen nicht zu trennen sind, glauben wir sagen zu dürfen, dass den farbigen Gegenständen ihre Plätze angewiesen werden. Dennoch stimmt das nicht oder jedenfalls nicht ganz. Im Konzept von Ellen Heinemann werden den Farben Plätze angewiesen, Farben, die sich jedoch von ihren Körpern nicht trennen können, die plastisch sind, Raum beanspruchen – die Körper – und daher nie rein farblich, also farbkompositorisch Platz nehmen können. Konzepte brauchen immer mindestens zwei Bedingungen. Hier handelt es sich um Farben an signifikante Körper gebunden und um Körper mit signifikanten Farben. Es geht also nicht darum, einem Geist zu sagen, er möge doch bitte Platz nehmen. Der konzeptuelle Umgang mit der Präsentation der „Sammlung“ besteht also darin, die Körper und die Farben weder schlicht in eins zu setzen, noch sie voneinander isolieren zu wollen, sondern sowohl die Farben für sich und mit den Körpern als auch die Körper für sich und mit den Farben in den Einklang einer gesteigerten Gegenwärtigkeit zu bringen. Nun kommt jedoch in der Betrachtung der „Sammlung“ ein anderes Element ins Spiel, das dem Betrachter als Kunstbetrachter eher ärgerlich erscheinen könnte. Selbst wenn er Farblinien oder -wege oder Gegenstandsbeziehun-gen in der Anordnung ausmachen oder verfolgen kann, wird er – vielleicht sich schon von der Betrachtung abwendend – Zufall als anti-gestalterische Kraft argwöhnen. Mit diesem Schritt hat er das konzeptuelle Feld verlassen, indem er Konzeptualität und Zufälligkeit für sich als unvereinbares und interaktivitätsunfähiges Gegen-satzpaar in seiner Vorstellung und seinem Denken etabliert hat. Jedoch hat Ellen Heinemann in ihrer Examensarbeit von 1984 an der Bremer Kunsthochschule dem Verhältnis von Zufall und Gesetzmäßigkeit besondere Aufmerksamkeit zugewendet und dabei Interdependenzen entdeckt, die sich künstlerisch entfalten lassen, wenn zwischen diese beiden Prinzipien keine Ausschließlichkeiten geschoben werden. Seitdem
arbeitet sie an der Entfaltung dieser Haltung nicht nur als künstlerischer Konzeption sondern auch als Dimension gesellschaftlicher Verständigung. Ihre Arbeiten sind nicht unmittelbar politisch oder gesellschaftskritisch, verweisen aber zumindest auf die Problematik von sozialen Platzhaltungen, deren Legitimation durch fragwürdige Traditionen, nicht wirklich entscheidungsfundierte Wahlen und akklamierte Berufungen eher wackelig dastehen.
Viele Arbeiten von Ellen Heinemann sind „ohne Titel“, was ja noch lange nicht heißt, dass sie ohne Inhalt sind. Wenn Titel auftauchen, lassen sie besonders aufhorchen. Sie nehmen dann oft Bezug auf politische Ereignisse oder auf religiöse Inhalte. Das muss erst einmal nicht nur untereinander sondern auch in Bezug auf Kunst in zumindest: plausiblen, besser: begründeten Zusammenhang gebracht werden; denn Heinemanns Bilder erscheinen doch abstrakt: Farben und Formen, Teilungen und Rhythmen, Leeren und Dehnungen, Pausen und Füllungen, Flächen- und Volumenverhältnisse, Massenentsprechungen, als Gipfel der Goldene Schnitt, gesucht oder einfach gefunden, gesehen und im Nachhinein gemessen bestätigt. Das sind sie und nicht zumindest. Heinemanns Bildraum, wie logisch er auch immer in sich selbst zu sein scheint, verweist immer über sich hinaus auf den umgebenden Raum, sei er architektonisch oder sozial, nein beides.

Es sind ja auch Bilder, allerdings mit hohen malerischen Anforderungen. Aber wenn wir von Inhalten der Malerei von Ellen Heinemann reden, geht es selbst wenn es sich um eine Arbeit mit dem Titel „The Last Supper“ handelt, nicht um Ikonographie, nicht um Inhalte, die sich im Rahmen eines Bildes interpretationsfähig etablieren, sondern um Verständnisse, die in die Welt hinauswollen. Um das nachvollziehbar zu machen, zeige ich drei Schritte im Werk von Ellen Heinemann auf. 1984 entsteht eine dreiteilige Arbeit mit Malerei auf der Stoffbespannung von Feldbetten. In einer alle Werkanalyse auslassenden interpretatorischen Wahrnehmung setzt sich die Malerei sehr strikt mit Flächenaufteilungen auseinander und sieht am Ende doch auch so aus wie das Muster, das Verbände und Heilversuche auf einem sehr verletzten Körper hinterlassen. An diesem Werk lassen sich sehr gut zwei durchgängige Prinzipien der künstlerischen Arbeit von Ellen Heinemann verdeutlichen. Die ‚abstrakten‘ Gesetzmäßigkeiten, Farbbeziehungen, Flächenverhältnisse werden sehr streng etabliert und durchgehalten. Die innerbildlichen Logiken grenzen sich jedoch nicht vom gesellschaftlichen und politischen Leben ab, sondern bleiben ihm gegenüber offen.
Es kommt also nicht darauf an, die Inhalte in die Bilder hineinzuziehen, sondern sie von ihnen auszuschicken. Das heißt, sich und die Bilder einzumischen. So geschehen 1998 während der Wahlkampfphase im Bremer Stadtteil Schwachhausen, wo Heinemann Bilder auf üblichen Wahlplakatträgern im öffentlichen Raum installiert hat. Das geschah im Rahmen des Projektes „Topoi – Kunst entlang der Schwachhauser Heerstraße“. Das war eine Einmischung in die stereotype Abfolge von Wahlplakaten. Es handelte sich ja nicht um Entlarvungsästhetik von Klaus Staeck und war um so provozierender. Die Tafeln wurden Ziel von Zerstörungen. Die politischen Muster ertrugen die künstlerischen nicht. Es wurde also sehr wohl begriffen, was die voneinander unterscheidet. Hier handelt es sich um ein Machtverhältnis. Die politischen Muster schlagen die künstlerischen immer. Die künstlerischen Muster unterscheiden sich qualitativ von den politischen, deshalb muss die Politik sie bekämpfen und vernichten.
1993/94 hat Ellen Heinemann im Auftrag der Senatorischen Behörde für Kultur und Ausländerintegration eine Arbeit im Gebäude GW2 (Geisteswissenschaften) der Universität Bremen realisiert. Das Projekt, in dessen Rahmen diese Arbeit entstand, hieß „An einem anderen Ort“. Wenn man den Titel des Projektes in Beziehung setzt zu dem Namen der Behörde, die den Auftrag erteilt hat – Helga Trüpel
(Bündnis 90 / Die Grünen) war damals Bremer Senatorin –, dann kann man doch nur so denken, dass die Behörde für Kultur und Ausländerintegration sich den anderen Ort als einen vorstellt, der zwar anders aber nicht fremd ist. Das Andere will man ja immer kennen lernen. Wenn wir auf heutige Verhältnisse schauen, wissen wir, dass diese Verbalersetzung von Fremdem und Anderem nicht nur nichts genützt hat, sondern wahrscheinlich katastrophal verblendend und die sozialen Probleme plattwälzend gewirkt hat. Auf eine wohl tragisch zu nennende Art ist die Arbeit von Ellen Heinemann an dem gegebenen Ort nicht nur als anders, sondern als so fremd erschienen, dass sie im Zuge von Umbaumaßnahmen von GW2 entfernt wurde und nur mit Mühe, wenngleich beschädigt, in irgendwelche Lagerräume des Landes Bremen ‚gerettet‘ werden konnte. Bei der Arbeit handelte es sich um zwei sich überschneidende, von der Decke des zentralen Treppenhauses des Geisteswissenschaftlichen Gebäudes abgehängte Leinwandtafeln. Die gegen die Fensterfront stehende, unüberschnittene blaue Tafel zeigte im Zentrum eine in ein kleines Quadrat eingeschriebene, inselartige Form als ein Ruhepunkt für das Auge in dem Überangebot architektonischer Information des Gebäudes GW2. Die Arbeit ist doppelteilig. Hinter der schon erwähnten blauen Tafel erschien eine versetzte gelbe, die – in frontaler Ansicht – dem blauen Quadrat einen gelb angelegten Winkel verpasste. Im Rahmen der beliebig funktional-ästhetischen Architektur erfüllte die Arbeit eine bedeutende formale und inhaltliche Funktion. Sie las der Architektur von GW2 die von dem Gebäude selbst postulierten aber nicht erfüllten Leviten. Da die Arbeit entfernt worden ist, ist nur noch an Fotografien überprüfbar, wie sie hätte wahrgenommen werden können. Sie befand sich dort in unmittelbarer Nähe und Blickbeziehung zu einer anderen Arbeit, einer Wandmalerei von einem anderen Künstler, die in realistischer Manier den Wettlauf von Studenten nach lukrativen Wissenschaftspfründen zu symbolisieren versuchte und die noch erhalten ist. In Ellen Heinemanns Arbeit fand die Auseinandersetzung mit dem Ort und dem umgebenden Raum auf ganz andere Weise, nicht inhaltistisch, statt. Die Platzanweisung erfolgte hier in einem sehr komplexen und verwirrenden architektonischem und sozialem Umfeld. Eine besondere Pointe als Platzhalterin erhielt sie durch die Nachbarschaft von zwei miteinander konkurrierenden Farbleitsystemen des Gebäudes GW2, einem technischen und einem inhaltlich-organisatorischen. Studenten auf der Suche nach den rot symbolisierten Räumen des Fachbereichs Ästhetik und Kommunikation hätten leicht im Keller landen können, wenn sie den ebenfalls rot markierten, wärmeführenden Leitungen des Belüftungs- und Heizungssystems gefolgt wären. Nicht nur dagegen setzte die Arbeit von Heinemann einen klar definierten Kontrapunkt.
Für die Universität Bremen wäre die Entfernung der Arbeit von Ellen Heinemann dann ein Verlust, wenn im Gebäude Geisteswissenschaften, also am Ort und in den Lehrveranstaltungen, würde verstanden werden können, dass die Erkenntnispräzisierungen, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Kunst bewerkstelligen können, essentielles Element der wissenschaftlichen Ausbildung und sein muss.
An zwei Abbildungen in diesem Katalog wird besonders deutlich, wie räumlich und körperlich präsent die Farben von der Künstlerin gesetzt werden. Das eine Foto zeigt die Künstlerin mit einer Arbeit von 1988, senkrecht an ihren Rücken gelehnt. Dass bei den meisten Bildern von Heinemann die Kanten der Leinwände bemalt sind oder besser, sich die Malerei der Schauseite auf die Kanten fortsetzt, wird hier besonders sinnfällig. Das Verhältnis von Bild und Körper ist wie das von Bogen und Sehne aber auch eines wie von Maß und Gemessenem. Auf dem anderen Foto sehen wir die Künstlerin mit dem waagerecht gehaltenen „Wanderstab“ von 1988 einen großen ‚überspringenden‘ Schritt machen auf einer historischen Steinanordnung (Hünengrab), wie sie sich zahlreich im weiteren Umland Bremens finden. Man kann dieses Bild auch als einen Beleg dafür lesen, wie wenig die Platzanweisungen für Farben in den künstlerischen Arbeiten von Heinemann konstruktivistischen Prinzipien folgen, wenn man das nicht sowieso schon erkannt hätte. Die Platzanweisungen liegen vielmehr im Strom von Farbbewegungen in die Bilder hinein und aus den Bildern heraus.
Man würde das den in Ölfarbe gehaltenen, in langwierigen Malprozessen angelegten Tafelbildern der letzten Jahre vielleicht nicht ohne weiteres abgelesen haben. Aber der folgende Text von Hanne Zech macht darauf aufmerksam, wie viel Farbbewegung – in die Tiefe und aus der Tiefe, aus dem Raum in die Fläche und aus der Fläche in den Raum – auch bei diesen Werken wirksam ist. Die großflächi-gen Tafelbilder atmen ruhiger als frühere Arbeiten, doch sind auch sie nicht statisch, sondern dynamisch, wenngleich gedehnter. Mehr Zeit zum Ein- und Aussteigen bei den Haltestellen
der Farben.
Knut Niervers